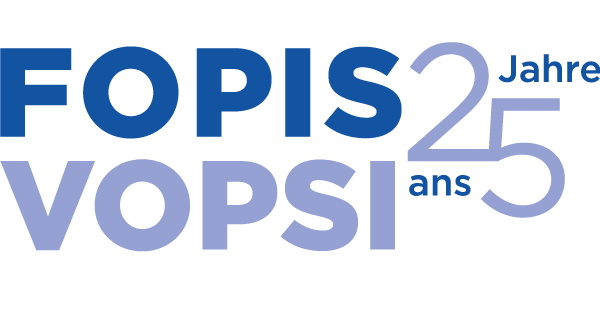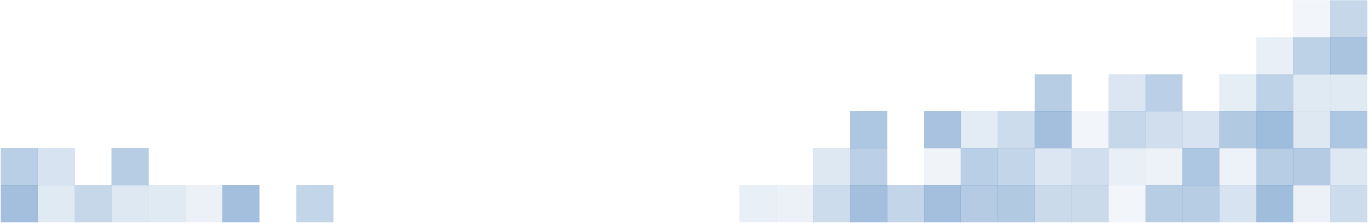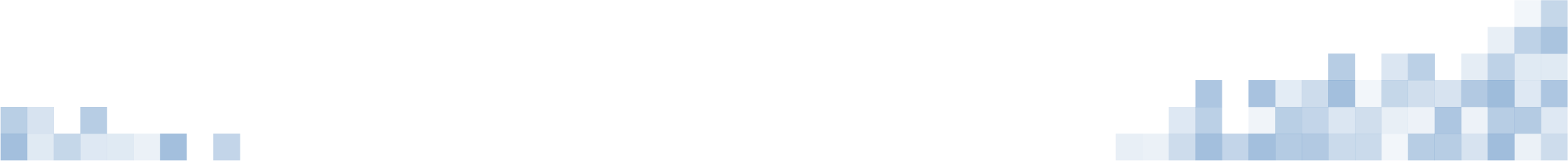Die Frage des Monats
Wer sind die Mitglieder des VOPSI?
Der VOPSI ist ein Dachverband: Er umfasst acht Berufsverbände und Gewerkschaften im Sozialbereich (siehe letzte Seite). Der VOPSI hat zum Ziel, die Kollektivmitglieder gegenüber dem Arbeitgeber zu unterstützen, insbesondere durch die Aushandlung des Gesamtarbeitsvertrags mit INFRI. Der VOPSI hat also keine Einzelmitglieder.
Der VOPSI hat zum Ziel, die Kollektivmitglieder gegenüber dem Arbeitgeber zu unterstützen, insbesondere durch die Aushandlung des Gesamtarbeitsvertrags mit INFRI. Der VOPSI hat also keine Einzelmitglieder.
Hingegen haben die acht beruflichen und gewerkschaftlichen Organisationen Einzelmitglieder, deren Interessen sie gemäss ihren Statuten vertreten.
Der VOPSI überwacht zusammen mit INFRI die korrekte Anwendung des GAV in den Institutionen.
Daher informiert der VOPSI alle Kolleginnen und Kollegen, die in einer dem GAV INFRI-VOPSI unterstellten Institution tätig sind, über ihre Rechte und Pflichten (unabhängig davon, ob sie in einer Organisation Mitglied sind).
Siehe die Antwort
Das Bundesgesetz über die Information und Mitsprache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben, das sogenannte Mitwirkungsgesetz, regelt die Einrichtung einer Arbeitsnehmervertretung. Die Aufgabe einer solchen Vertretung ist es, die gemeinsamen Interessen der Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten. Ausserdem muss sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmässig über ihre Tätigkeit informieren (Art. 8).
Erste Voraussetzung für die Einrichtung einer Personalvertretung ist, dass das Unternehmen dauerhaft mindestens fünfzig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat (Art. 1 und 3). Der Antrag, eine Abstimmung über die Bildung einer Arbeitsnehmervertretung durchzuführen, muss von mindestens einem Fünftel der Belegschaft gestellt werden (Art. 5 Abs. 1). Es folgt eine geheime Abstimmung (Art. 5 Abs. 1). Spricht sich eine Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bildung einer Arbeitnehmervertretung aus, müssen anschliessend Wahlen durchgeführt werden (Art. 5 Abs. 2).
Die Anzahl der Mitglieder der Vertretung wird gemeinsam von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite festgelegt. In diesem Zusammenhang stellt das Gesetz klar, dass die Grösse und die Struktur des Unternehmens angemessen berücksichtigt werden müssen (Art. 7).
Die Vertretung hat das Recht, rechtzeitig und umfassend über alle Angelegenheiten informiert zu werden, deren Kenntnis für die ordnungsgemässe Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Insbesondere muss der Arbeitgeber mindestens einmal im Jahr über die Auswirkungen des Geschäftsverlaufs auf die Beschäftigung des Personals informieren (Art. 9).
Die Vertretung hat ein Mitwirkungsrecht in vier besonderen Bereichen, die alle in einem Bundesgesetz geregelt sind: in Fragen der Arbeitssicherheit, beim Übergang von Betrieben, bei Massenentlassungen und beim Anschluss an eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge und der Auflösung einer entsprechenden Vertrags (Art. 10).
Die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber beruht auf dem Grundsatz von Treu und Glauben. Der Arbeitgeber muss die Arbeitnehmervertretung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unterstützen. Er stellt die notwendigen Räumlichkeiten, Hilfsmittel und administrativen Dienstleistungen zur Verfügung (Art. 11).
Die Mitglieder der Arbeitnehmervertretung geniessen insofern Schutz, als sie während der Ausübung ihres Mandats und danach nicht benachteiligt werden dürfen. Dies gilt auch für Personen, die sich für die Wahl in die Vertretung aufstellen lassen (Art. 12). Auf der anderen Seite sind die Mitglieder der Vertretung während und nach ihrer Amtszeit zur Verschwiegenheit verpflichtet (Art. 14).
Die Tätigkeit kann während der Arbeitszeit ausgeübt werden, sofern das Mandat dies erfordert und die berufliche Tätigkeit dies zulässt (Art. 13). In diesem Fall ist eine Freistellung mit dem Arbeitgeber zu besprechen.
Siehe die Antwort
Darf man während der Arbeitszeit zum Arzt gehen?
Der Schiedsrat hat am 23. August 2012 zur Frage Stellung genommen, ob man während der Arbeitszeit einen ärztlichen Termin wahrnehmen darf. Art. 20 GAV (Abs. 2 bis 6) zählt die Gründe für einen bezahlten Kurzurlaub abschliessend auf. Der Arztbesuch zählt nicht dazu.
Ergänzend hält Art. 20.1 GAV fest, dass ein Urlaub beantragen muss, wer die Arbeit aus einem anderen Grund als Ferien, Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, Mutterschaft oder Militärdienst aussetzen will. In Art. 26 GAV wird die Lohnfortzahlung bei Krankheit oder Unfall geregelt.
Der Besuch eines Arztes kann tatsächlich ein Hinderungsgrund ohne Verschulden sein, der in der Person des Beschäftigten liegt. In diesem Fall muss der Lohn für die Dauer der Verhinderung bezahlt werden.
Hingegen gilt dies nicht, wenn der Beschäftigte die Möglichkeit hätte, den Arztbesuch ausserhalb der Arbeitszeit zu erledigen. Dies ist insbesondere bei Beschäftigten in Teilzeit oder mit gleitender Arbeitszeit der Fall, die ihre Arbeitzeiten relativ selbständig gestalten.
Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Fällen ist nicht immer einfach. Institutionen können diesbezüglich interne Richtlinien für verschiedene Kategorien von Arbeitszeiten erlassen (vorgeschriebene oder flexible Arbeitszeit o. ä.).
Die Richtlinien des Freiburger Amtes für Personal und Organisation (POA) und insbesondere jene betreffend Arztbesuch «gelten weder unmittelbar noch sinngemäss für die dem GAV INFRI-VOPSI unterstellten Beschäftigten». Der Wortlaut der Stellungnahme ist auf unserer Webseite aufgeschaltet.
Siehe die Antwort
Kann der Arbeitgeber einen Wechsel des Arbeitsortes vorschreiben?
Der GAV INFRI-VOPSI führt in Artikel 3.2 auf, was alles im Arbeitsvertrag erwähnt sein muss (die Benennung des Arbeitsplatzes oder der Funktion, der Beschäftigungsgrad, das Anstellungsdatum, die Dauer der Probezeit, das Datum der nächsten jährlichen Lohnerhöhung, die Referenz in der Lohnklasse und die Stufe in der Lohnskala, die Vertragsdauer, die Bestimmungen über Vertragserneuerungen, das Ferienguthaben, allfällige besondere Bestimmungen). Da der Arbeitsort nicht zwingend erwähnt sein muss, unterliegt er also der Weisungsbefugnis des Arbeitgebers. Dieser darf sein Recht auf Anweisungen und Bestimmungen (einschliesslich jener zum Arbeitsort) nicht völlig willkürlich ausüben. Der Arbeitgeber muss die Persönlichkeit des Arbeitnehmers (Art. 328 des Obligationenrechts) sowie den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 321d Abs. 2) berücksichtigen. Der Arbeitgeber kann also „den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen keinesfalls Änderungen aufzwingen, die mit deren persönlicher, familiärer oder gesellschaftlicher Situation unvereinbar sind“ (Brunner, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht 2005, S. 50f.). Ebenso muss er Art. 27 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches einhalten, der vorsieht: „Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.“
Wurde der Arbeitsort einvernehmlich (durch eine Zusatzklausel des Arbeitsvertrags oder durch übliche Praxis) festgelegt, bedarf es der Zustimmung des Arbeitnehmers, um ihn ändern zu können, denn der Arbeitsvertrag kann vom Arbeitgeber nicht einseitig abgeändert werden.
Die Zeit, die der Arbeitnehmer braucht, um von zu Hause an seinen Arbeitsort zu gelangen, zählt nicht als Arbeitszeit. Die Fahrzeit von einem Arbeitsort zum anderen im Rahmen der Ausübung der Arbeit gehört dagegen zur Arbeitszeit. Das Gesetz sieht ebenfalls vor (Art. 327a ff. OR), dass alle für die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen vom Arbeitgeber zu tragen sind, wozu Transport-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten gehören (Anhang 5 GAV INFRI-VOPSI).
Arbeitnehmer, „deren Arbeitsausübung regelmässige und wiederkehrende Transporte verlangen, um verschiedene Arbeitsorte zu erreichen, werden als Angestellte im Aussendienst betrachtet“ (Anhang 5 GAV INFRI-VOPSI). Obwohl im Arbeitsvertrag nicht zwingend erwähnt, umfasst der Status eines „Angestellten im Aussendienst“ faktisch die Definition eines Hauptarbeitsortes sowie eine Mobilitätsklausel, die den Arbeitnehmer verpflichtet, sich je nach Bedarf an Leistungen an verschiedene Arbeitsorte zu begeben. Gemäss Anhang 5 GAV INFRI-VOPSI wird als Hauptarbeitsort der Arbeitsort betrachtet, der in der Wohngemeinde oder dieser am nächsten liegt. Für die Umwandlung der Fahrzeit zwischen dem Hauptarbeitsort und den anderen Arbeitsorten in Behandlungseinheiten gelten für das auswertige Personal Sonderregelungen.
Siehe die Antwort
Wie lauten die Bedingungen für die Frühpensionierung ab 1. Januar 2012?
Die Revision des Gesetzes über die Pensionskasse des Staatspersonals führt zu Änderungen bei der Gewährung und Berechnung des AHV-Vorschusses (AHV-Überbrückungsrente):
- Die Bedingungen für eine volle oder teilweise Pensionierung ab dem vollendeten 58. Lebensjahr werden vom Reglement der Pensionskasse der Institution geregelt, in dem die Person arbeitet.
- Um einen AHV-Vorschuss zu beziehen, muss eine Person insgesamt 13 Jahre bei einer oder mehreren spezialisierten Institutionen (oder beim Staat) gearbeitet haben.
- Bei Teilpensionierung muss ein Mindestbeschäftigungsgrad von 40 Prozent beibehalten werden.
- Der durch den Staat finanzierte AVH-Vorschuss beträgt 90 Prozent der maximalen AHV-Rente (CHF 2’320.-), also CHF 2’088.- im Jahr 2012.
- Der AHV-Vorschuss wird Männern von 60 bis 65 Jahren und Frauen von 60 bis 64 Jahren ausbezahlt.
- Bei einer Pensionierung im Alter von 58 Jahren verteilt sich der AHV-Vorschuss auf 7 Jahre (maximal CHF 1’491,40 monatlich während 84 Monaten).
- Der AHV-Vorschuss wird aufgrund des mittleren Beschäftigungsgrads der letzten 7 Jahre berechnet (oder der letzten 13 Jahre, wenn dies für die betroffene Person günstiger ausfällt).
Der AHV-Vorschuss muss mindestens drei Monate vor dem Zeitpunkt der Pensionierung schriftlich beim Arbeitgeber beantragt werden. Die Institutionen müssen ein entsprechendes Formular bereitstellen und dieses dem Kanton Freiburg (EKSD oder GSD) mit einer Stellungnahme weiterleiten.
Diese neue Regelung ist am 1. Januar 2012 in Kraft getreten.
Siehe die Antwort
Wie steht es um den Datenschutz für Angestellte?
Das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) bezeichnet für das Sammeln und Nutzen von Daten über Beschäftigte enge Grenzen. Der Arbeitgeber «darf Daten über den Arbeitnehmer nur bearbeiten, soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrages erforderlich sind» (Art. 328b OR). Hierbei geht es um Diplome, frühere Arbeitszeugnisse, Daten über Alter, Wohnort, Zivilstand, AHV-Nummer, Post- oder Bankkontonummer. Hinzu kommen je nachdem Informationen wie ärztliche Arbeitsunfähigkeitszeugnisse, Leistungsbeurteilungen, Nachweise über Weiterbildungen sowie den mit den Beschäftigten geführten Briefwechsel. Der Arbeitgeber muss die Informationen, die er über seine Angestellten besitzt, nach Treu und Glauben behandeln (es dürfen keine Informationen ohne Wissen der Beschäftigten oder gegen ihren Willen erhoben werden). Weiter muss er die Verhältnismässigkeit wahren (nur solche Informationen sammeln, die für die Ausführung der Arbeit wirklich nötig sind und nicht etwa Informationen über eine einzelne Person für alle sichtbar aushängen). Auch die Qualität der Daten muss garantiert sein (die festgehaltenen Informationen müssen der Wahrheit entsprechen).
Es ist dem Arbeitgeber untersagt, Daten über die Beschäftigten zu sammeln, die zur Durchführung des Arbeitsvertrages nicht nötig sind. Dies gilt insbesondere für sogenannt sensible Daten (religiöse, philosophische, politische oder gewerkschaftliche Meinungen oder Aktivitäten, gesundheitlicher Zustand, Intimsphäre oder ethnische Zugehörigkeit, Massnahmen betreffend Sozialhilfe, Betreibungen, strafrechtliche oder administrative Sanktionen). Ausgenommen von dieser Regelung sind Daten, die für die Berufsausübung benötigt werden (z.B. Vorweisen eines Strafregisterauszugs bei der Anstellung als Sozialpädagoge).
Die Beschäftigten haben das Recht, ihr persönliches Dossier einzusehen. Sie können jederzeit beim Arbeitgeber vorsprechen und Einsicht sowie Korrektur von fehlerhaften Informationen verlangen. Auch dürfen sie eine kostenlose Kopie der Dokumente fordern. Verweigert der Arbeitgeber die Einsicht in das Dossier sowie die Korrektur oder Löschung von unrichtigen Daten, so können die Beschäftigten gerichtlich die Einsicht einfordern und gegebenenfalls die nötigen Korrekturen veranlassen.
Der Arbeitgeber darf Daten über sein Personal nicht an Dritte weiterleiten, insbesondere nicht an potentielle künftige Arbeitgeber, ausser die Beschäftigten haben sich ausdrücklich mit einem solchen Vorgehen einverstanden erklärt.
Siehe die Antwort
Wie wird der Einstiegslohn festgelegt?
Der Einstiegslohn für neu eingestellte Mitarbeitende hängt in erster Linie von der Funktion ab. Zum Beispiel wird ein Logopäde der Lohnklasse 20 zugeteilt, eine Sozialpädagogin im Werkstattbereich mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis und Abschluss auf Ebene Höhere Fachschule wird in die Klasse 18 eingeteilt.
Für jede Lohnklasse gilt ein Mindest- und ein Höchstansatz. Die Lohnstufe wird in Abhängigkeit von beruflicher und persönlicher Erfahrung festgelegt.
Berücksichtig werden die Erfahrungsjahre im Beruf oder in der Funktion, für welche die Person eingestellt wird. Jedes Berufsjahr entspricht einer Stufe der Lohnklasse.
Wurde die Berufserfahrung in einem anderen Bereich als die neue Funktion und mit einem Pensum von mindestens 50% erworben, so ergibt sich je nach Art der früher ausgeübten Tätigkeit ein Anrecht auf eine bis drei Stufen.
Wer seine berufliche Tätigkeit unterbrochen hat, um eigene Kinder (bis zum vollendeten 16. Lebensjahr des jüngsten Kindes) zu betreuen, kann für drei volle Jahre eine Lohnstufe erhalten, jedoch maximal drei Stufen. Diese Regel gilt auch für Personen, die eine Betreuungsaufgabe oder eine sozio-kulturelle oder humanitäre Tätigkeit in einer öffentlichen oder einer anerkannten, gemeinnützigen Institutionen übernommen haben.
Wer nicht über die Ausbildung oder Erfahrung zur Ausübung der neuen Funktion verfügt, wird in einer tieferen Lohnklasse (Einstiegslohn) eingereiht als für die Funktion üblicherweise vorgesehen. Sobald die Person nach einer berufsbegleitenden Ausbildung die Erfordernisse der Funktion erfüllt, wird der Lohn an die oben genannten Kriterien angepasst (Funktionsklassen).
Siehe die Antwort
Was sind Überstunden, und wie müssen diese kompensiert werden?
Überstunden sind diejenigen Stunden, die über die normale Arbeitszeit hinaus geleistet werden, die im Vertrag und im GAV vorgesehen ist: 42 Stunden pro Woche (bei Vollzeitanstellung), grundsäzlich verteilt auf 5 Tage, was einer durchschnittlichen Jahresarbeitszeit von 1900 Stunden entspricht. Anhang 6 GAV regelt die besonderen Bestimmungen für die Sozialpädagogen/
Erzieherinnen, für die Sonderschul-Lehrpersonen und für das medizinische und psycho-pädagogische Personal.
Die Angestellten sind verpflichtet, Überstunden auszuführen, sofern sie dazu in der Lage sind und dies nach den Regeln von Treu und Glauben von ihnen verlangt werden kann. Überstunden, die über die normale Arbeitzeit hinaus erbracht werden, müssen im Interesse des Arbeitgebers liegen. Dies ist dann offensichtlich der Fall, wenn sie auf Anweisung des Arbeitgebers geleistet werden. Falls der Angestellte die Initiative ergreift, werden diese Stunden als «Überstunden» betrachtet, sofern sie objektiv im Interesse des Arbeitgebers liegen und berechtigt sind (wenn es zum Beispiel auf Grund einer Dringlichkeit unmöglich ist, anders vorzugehen) sowie der Arbeitgeber davon Kenntnis hat. Es wird deshalb wärmstens empfohlen, den Arbeitgeber so rasch wie möglich zu informieren. Dies um zu verhindern, dass diese Überstunden im Nachhinein in Frage gestellt werden. Der Beweis, dass Überstunden geleistet wurden und berechtigt waren, ist nach einigen Monaten oder Jahren viel schwieriger zu erbringen.
Zur Definition von Überstunden siehe die letzte Info-Nummer (VOPSI Info vom September 2008).
Beschäftigte können nicht zu mehr als 120 Überstunden pro Kalenderjahr angehalten werden.
Im GAV ist vorgesehen, dass Überstunden im Verhältnis von einer Stunde für eine Überstunde kompensiert werden müssen. Überstunden müssen innerhalb von sechs Monaten eingezogen werden. Ist der Bezug in Form von Freizeit nicht möglich, müssen Überstunden gemäss Monatslohn pro Stunde zuzüglich ¼ ausbezahlt werden.
Werden Überstunden nachts oder an einem arbeitsfreien Tag geleistet, so müssen sie selbst dann bezahlt werden, wenn sie durch Freizeit kompensiert werden. Die Entschädigung für Überstunden in der Nacht oder an arbeitsfreien Tagen beträgt CHF 7,30.
Siehe die Antwort
Artikel 42 des GAV behandelt nicht vorgesehene oder vorbehalten Bestimmungen. Solche Bestimmungen finden sich oft in Gesetzestexten. Was bedeuten sie?
Siehe die Antwort
Muss ich der Institution, in der ich zum Zeitpunkt des Abschlusses meiner Ausbildung gearbeitet habe, die Kosten zurückerstatten?
Am 1. Juli 2024 ist eine GAV-Änderung zu diesem Thema in Kraft getreten. Ab jetzt wird zwischen vom Arbeitgeber vorgeschriebener Aus- und Weiterbildung, zur Berufsausübung erforderlicher Aus- und Weiterbildung, Aus- und Weiterbildung von gegenseitigem Interesse, Aus- und Weiterbildung im ausschliesslichen Interesse der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters und berufsbegleitender Grundausbildung
unterschieden.
Die Rückzahlungsfrist, das heisst der Zeitraum, in dem Mitarbeitende verpflichtet sind, beim Arbeitgeber zu bleiben, der die Ausbildung finanziert hat, greift künftig oberhalb der Schwelle von Fr. 5’000.-. Zwischen Fr. 5001 und Fr. 10’000 beträgt die Rückzahlungsfrist 12 Monate, zwischen Fr. 10’001 und Fr. 15’000 24 Monate und ab Fr. 15’0001, 36 Monate Eine Ausbildungsvereinbarung wird also ab Ausbildungskosten in Höhe von Fr. 5001 abgeschlossen.
Die Übernahme der Ausbildungskosten wurde ebenfalls angepasst, so richtet sie sich nicht mehr nach dem Beschäftigungsgrad der oder des Angestellten. Weiter hängt die Kostenübernahme von der Art der Ausbildung ab (siehe Art. 35.3).
Und schliesslich hat sich noch geändert, dass die Kostenübernahme auf den neuen Arbeitgeber übergeht, wenn die Ausbildung noch nicht beendet ist oder die Ausbildungsvereinbarung in Kraft getreten ist, sofern es sich um eine Institution handelt, die dem GAV INFRI-VOPSI untersteht.
Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage lautet somit, dass keine Rückzahlung geschuldet ist, wenn der neue Arbeitgeber INFRI-Mitglied ist und sein Personal dem GAV untersteht. Jedoch muss die oder der Angestellte den neuen Arbeitgeber informieren, wenn eine Ausbildungsvereinbarung vorliegt. Die Rückzahlungsfrist gilt dann beim neuen Arbeitgeber.
Siehe die Antwort